Folgende drei Beispiele sollen einen Eindruck vermitteln,
welche Entwicklungen und Ereignisse die Informationsversorgung zu Anspruchsgruppen
(Stakeholder) eines Unternehmens anstoßen können. Stakeholder Information Systems
dienen dazu, die richtigen Informationen im richtigen Moment mithilfe
personalierter Portale/Meldungen zur Verfügung zu stellen.
Spätestens 2004 wird die Kreditbonität der meisten Firmenkunden in nur einer "Note" ausgedrückt sein.
Dies zeigt eine Umfrage unter Banken, die rund 70% aller Firmenkredite in Deutschland vergeben.
Die risikoabhängige "Kreditbepreisung" führt nach der CREDITREFORM in Deutschland bei 46% aller
(stark bankenabhängigen) mittelständischen Unternehmen in den neuen Bundesländern und bei 24%
in den alten zu einer höheren Eigenkapitalunterlegung.
Die Folge ist, dass auf die Betriebe erweiterte Transparenz- und Offenlegungspflichten zukommen.
So fordern Banken beispielsweise Kennzahlen aus Modellen zur Prognose von Insolvenzen,
wie Verschuldungs-, Rendite- oder Liquiditätskennzahlen.
Rund ein Drittel qualitativer Informationen über Produkt, Markt oder Führung gehen in die Analyse ein.
Die Bonitätsbewertung kann auch zur Außenwirkung herangezogen werden, z. B. wenn die Einstufung auch Lieferanten, Arbeitnehmer oder Anteilseignern mitgeteilt wird.
Siehe Checkliste zum Stakeholder: Rating-Analyst
| 2. Krisen- und Erfolgssituationen
|
Kleinere und mittlere Unternehmen sind naturgemäß selten für Krisenfälle gerüstet.
Nach einer EMNID-Umfrage verfügen selbst Großunternehmen nur in einem von fünf Fällen
über ein Budget zur Krisenvorbeugung, obwohl 80% von der Bedeutung der Krisenkommunikation
überzeugt sind.
Fälle wie bei dem Nudelhersteller Birkel zeigen, dass Schwächen in der Unternehmenskommunikation,
gepaart mit einer zunehmend kritischeren Presse, eine Krisensituation verselbständigen können.
Eine solche Spirale der Kommunikation ist vom Unternehmen kaum mehr steuerbar („Publizitätskrise”).
Um im Ernstfall nicht ein Informationsvakuum entstehen zu lassen,
das "Netz-Klatsch" nährt und den hart erarbeiteten guten Ruf ruiniert,
richten immer mehr Betriebe Webseiten quasi auf Vorrat ein.
Diese verdeckten Webseiten ("Dark Sites") für Krisen oder öffentliche Diskussionsthemen bleiben zunächst
unsichtbar und werden erst im Bedarfsfall freigeschaltet.
Dann aber können sie sehr schnell die erforderlichen Informationen liefern.
Siehe Checkliste zum Trigger: Krise
| 3. Anbieterpflichten und Kundenrechte
|
Der Betrieb einer eigenen Webseite ist mit zahlreichen rechtlichen Auflagen verbunden.
Ein grundlegender Anspruch von Kunden ist es, leicht den Anbieter zu erkennen.
So müssen nach dem Teledienstegesetz auf der Webseite Name, Anschrift, Kontaktdaten und
Handelsregisterdaten einsehbar sein.
Mit der Verordnung über Informationspflichten (InfoV)ist der Verbraucherschutzgedanke
im Internet gesetzlich verankert worden.
Adressaten im kaufmännischen Geschäftsverkehr müssen nach §3 InfoV
z. B. über einzelne Vertragsschritte oder über Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstextes
Auskunft geben.
Aus der bisherigen E-Commerce-Richtlinie geht §312 e-f BGB zu Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr und über abweichende Vereinbarungen hervor.
Ferner verpflichtet das EGG (Elektronischer Geschäftsverkehr Gesetz)
z. B. in seinem §6 den Kunden die Vertretungsberechtigungen oder die Art des Dienstes mitzuteilen;
Versäumnisse können nach §12 EGG mit Ordnungsstrafen bis 50.000 EURO geahndet werden.
Der Verbraucher ist durch zusätzliche Vorschriften geschützt.
So müssen Unternehmen über wesentliche Produkt- und Dienstleistungsmerkmale aufklären.
Ferner sind Vorbehalte zu verdeutlichen, wenn der Handwerker beabsichtigt,
statt der bisher vereinbarten eine in Qualität und Preis gleichwertige Ware oder Dienstleistung
zu erbringen.
Siehe Checkliste zu Informationspflichten: Kunde
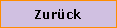
![]()